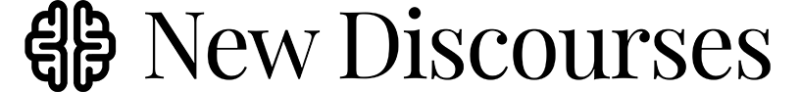Verwendung innerhalb der Theorie der Sozialen Gerechtigkeit
Quelle: http://www.qcc.cuny.edu/diversity/definition.html
Das Konzept der Diversität umfasst die Begriffe Akzeptanz und Respekt. Dies bedeutet sowohl das Verständnis, dass jedes Individuum einzigartig ist, als auch die Anerkennung unserer individuellen Unterschiede. Diese können gemäß der Kriterien Rasse, Ethnizität, Geschlecht, sexuelle Orientierung, sozioökonomischer Status, Alter, körperliche Fähigkeiten, religiöse Überzeugungen, politische Überzeugungen oder andere Ideologien vorliegen. Das Konzept der Diversität ist die Erforschung dieser Unterschiede in einer sicheren, positiven und fördernden Umgebung. Dies bedeutet, einander zu verstehen und über einfache Toleranz hinauszugehen, um die reichen Dimensionen der Diversität, die in jedem Individuum enthalten sind, anzunehmen und zu würdigen.
Diversität ist eine Realität, die von Einzelpersonen und Gruppen aus einem breiten Spektrum demographischer und philosophischer Unterschiede heraus geschaffen wird. Es ist äußerst wichtig, die Diversität zu unterstützen und zu schützen, indem wir durch die vorurteilsfreie Wertschätzung der Individuen und Gruppen und durch die Förderung eines Klimas, in dem Gerechtigkeit und gegenseitiger Respekt immanent sind, eine erfolgsorientierte, kooperative und solidarische Gemeinschaft schaffen werden, die aus der Synergie ihrer Mitglieder intellektuelle Kraft schöpft und innovative Lösungen hervorbringt.
„Diversität“ bedeutet mehr als nur die Anerkennung und/oder Toleranz von Unterschieden. Diversität umfasst eine Reihe von bewussten Praktiken, die folgendes einbeziehen:
- Verständnis und Wertschätzung der gegenseitigen Bedingtheit von Menschen, Kulturen und der natürlichen Umwelt;
- Den gegenseitigen Respekt für Qualitäten und Erfahrungen, die sich von unseren eigenen unterscheiden, zu praktizieren;
- Das Verständnis, dass Diversität nicht nur Wege des Seins, sondern auch Wege des Wissens umfasst;
- Die Anerkennung, dass persönliche, kulturelle und institutionalisierte Diskriminierung Privilegien für einige schafft und aufrechterhält, während sie Nachteile für andere schafft und aufrechterhält;
- Der Aufbau von Allianzen über Unterschiede hinweg, damit wir gemeinsam an der Beseitigung aller Formen von Diskriminierung arbeiten können.
Zur Diversität gehört daher auch das Wissen, wie man mit jenen Qualitäten und Konditionen umgeht, die sich von unseren eigenen und denjenigen außerhalb der Gruppen, zu denen wir gehören, unterscheiden, aber bei anderen Individuen und Gruppen vorhanden sind. Dazu gehören unter anderem Alter, ethnische Zugehörigkeit, Klasse, Geschlecht, körperliche Fähigkeiten/Qualitäten, Rasse, sexuelle Orientierung sowie religiöser Status, Geschlechtsausdruck, Bildungsstand, geografische Lage, Einkommen, Familienstand, Stellung der Eltern und Arbeitserfahrung. Zuletzt räumen wir ein, dass die Differenzierungskategorien nicht immer fixiert sind, sondern auch fließend sein können, wir respektieren individuelle Rechte auf Selbstidentifizierung, und wir erkennen an, dass keine Kultur einer anderen intrinsisch überlegen ist.
Kommentar des Neuen Diskurses
Das erste, was an dieser Definition von „Diversität“ auffällt, ist, dass sie seltsam lang wirkt und wahrscheinlich nicht mit der Definition übereinstimmt, die man für dieses Wort verwendet. Wahrscheinlich denkt man, dass „Diversität“ etwas darüber aussagt, dass unterschiedliche Identitäten und Standpunkte vertreten werden, und doch verlangt diese Definition sofort mehr, zunächst und vor allem, dass Unterschiede in einer „sicheren, positiven und fördernden Umgebung“ erforscht werden. Es erfordert auch, dass die Diversität „angenommen und gewürdigt“ wird. Daher ist es unter der Schirmherrschaft der Sozialen Gerechtigkeit geboten, dass „Diversität“ ein solches Umfeld schafft und aufrechterhält, was wiederum eine Kontrolle dieser Umgebung erfordert. Wie bereits angedeutet, schließt „Diversität“ das „Wissen“, wie man mit anderen über demographische Unterschiede hinweg „umgeht“, ein, was ebenfalls durch die Theorie kontrolliert werden soll (siehe auch: Inklusion).
Mit der Verwendung des Begriffs „Diversität“ im Gebrauch der Sozialen Gerechtigkeit wird zwar gelegentlich behauptet, tolerant gegenüber unterschiedlichen Ideen und politischen Standpunkten und „philosophischen Unterschieden“ zugeneigt zu sein, man konzentriert sich aber in Wirklichkeit fast ausschließlich auf physische und kulturelle Unterschiede, die gemäß den Konzeptionen von Privilegien und Marginalisierung der Sozialen Gerechtigkeit bewertet werden (siehe auch Positionalität). Sie zielt daher darauf ab, die Marginalisierten zu privilegieren und die Privilegierten zu marginalisieren, um die Ungleichgewichte, die sie in der Gesellschaft sieht, auszugleichen (siehe auch: Verteilungsgerechtigkeit (Equity) und progressive Liste). Dies wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass in diesem Gebrauch die Diversität als „eine Reihe bewusster Praktiken“ beschrieben wird. Das heißt, dass Diversität nicht nur etwas ist, was man unter der Rubrik Soziale Gerechtigkeit tun soll, sondern dass es eine Reihe von Praktiken ist, die eine bewusste Achtsamkeit erfordern (siehe auch Bewusstseinsbildung, Antirassismus und Erweckt-sein (woke)).
Das mag verwirrend erscheinen, aber das liegt daran, dass die Theorie der Sozialen Gerechtigkeit davon ausgeht, dass das Verhältnis zur systemischen Macht in der Gesellschaft wissensproduktiv sei. Das heißt, wer man demografisch ist und wie die Gruppenidentitäten mit der systemischen Macht in der Gesellschaft zusammenhängen, bestimmt, was man wissen kann und wie die Gesellschaft einen als potenziellen Wissenden schätzt. Die Theorie der sozialen Gerechtigkeit postuliert, dass die „Art und Weise, wie eine Person etwas weiß“, an ihre Identität und ihre Position in Bezug auf die (systemische) Macht in der Gesellschaft gebunden ist (siehe auch: Standpunkt-Epistemologie).
„Diversität“ im Gebrauch der sozialen Gerechtigkeit bedeutet daher tendenziell eine Uniformität der Sichtweise auf ideologische Sachverhalte. Die ganze Vielfalt der Standpunkte, aus der Perspektive der Bedeutung des Begriffs innerhalb der Theorie der Sozialen Gerechtigkeit, entsteht durch die Bereitstellung unterschiedlicher kultureller Kenntnisse, die nur dann als authentisch angesehen werden, wenn sie die fragliche Beziehung der Identitätsgruppe zur systemischen Macht, wie sie von der Theorie beschrieben wird, bekräftigen. (Denn die Theorie besteht darauf, dass verschiedene Identitätsgruppen identifizierbare Beziehungen zur systemischen Macht haben, die nur sie verstehen können – siehe auch gelebte Erfahrung – und dass diese in vielerlei Hinsicht diese Identitätsgruppe definieren. Dies wiederum folgt daraus, weil die Theorie der sozialen Gerechtigkeit systemische Macht und deren Unterdrückungsmechanismen als die einzigen objektiven Wahrheiten über die materielle Realität betrachtet – siehe auch: Essentialismus und Positionalität.)
Als abschließende Bemerkung enthält das oben genannte Beispiel eine Bemerkung zur Abhängigkeit der Diversität vom Kulturrelativismus, dass „keine Kultur einer anderen intrinsisch überlegen sei“. Es ist wichtig, hier zu erkennen, dass diese Aussage im Rahmen der Sozialen Gerechtigkeit nicht auf allgemein willkürliche kulturelle Sitten wie Kleidungsstile, Essen, Musik, Sprache usw. beschränkt ist, sondern auch die Überzeugung einschließt, dass wissensproduzierende und streitbeilegende Methoden – wie Wissenschaft, Liberalismus, Kapitalismus sowie Eigentum, Philosophie, Debattenkultur, Verlässlichkeit von Beweismitteln usw. – bloße kulturelle Relikte sind, die nicht aufgrund irgendeiner Überlegenheit miteinander verglichen werden können. Unter einer solchen Rubrik fallen auch Folklore, Aberglaube, Magie und Hexerei als kulturelle Artefakte, die wiederum von den anderen Artefakten wie Wissenschaft, Vernunft, Logik und Rechtsnormen nicht widerlegt werden können.
Verwandte Begriffe
Ally/allyship; Antiracism; Authentic; Capitalism; Cultural relativism; Equity; Essentialism; Identity; Ideology; Inclusion; Knowledge(s); Liberalism; Lived experience; Marginalization; Objectivity; Position; Power-knowledge; Privilege; Progressive stack; Race; Safe space; Science; Social Justice; Solidarity; Standpoint epistemology; Systemic power; Theory; Truth; Woke/Wokeness
Sprachen
Revisionsdatum: 3/24/20